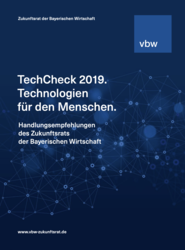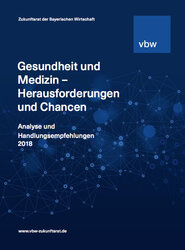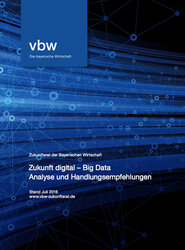Analysen und Handlungsempfehlung
Jedes Jahr befasst sich der Zukunftsrat mit einem großen Schwerpunktthema. Dazu wird zunächst eine Studie erstellt, die während ihrer Entstehungsphase intensiv im Zukunftsrat diskutiert wird.
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen formuliert der Zukunftsrat Handlungsempfehlungen an Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und ggf. Gesellschaft. Studie und Handlungsempfehlungen werden in einem großen Kongress der Öffentlichkeit vorgestellt und im Anschluss mit einer Veranstaltungsreihe in die bayerischen Regionen getragen.
Im Juni 2020 hat der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft seine Handlungsempfehlungen Resilienz – Schlussfolgerungen aus der Corona-Pandemie veröffentlicht. Ein Dreivierteljahr später erlebt Europa eine zweite beziehungsweise dritte Welle unter dem Einfluss zwischenzeitlich stark verbreiteter Mutationen. Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft zieht vor diesem Hintergrund nun eine Zwischenbilanz.
Er gelangt dabei zu dem Ergebnis, dass die Empfehlungen von Juni 2020 auch vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen nach wie vor ihre Berechtigung haben. Mehr als die Hälfte wurde inzwischen teilweise aufgegriffen, aber es stehen viele wesentliche Umsetzungsschritte noch aus.
Umsetzungsdefizite beim Umgang mit der aktuellen Krise sind weit überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Potenziale technologischer Lösungen und insbesondere der Digitalisierung nicht konsequenter im Dienst der Gesellschaft gehoben werden. Der Zukunftsrat unterstreicht daher in seinem Zwischenfazit noch einmal, an welchen Stellen jetzt entschlossen gehandelt werden muss, um den Standort resilienter aufzustellen.
Insgesamt zehn technologische Zukunftsfelder sind für Bayern bzw. Deutschland in den kommenden Jahren besonders relevant. Sie sind gekennzeichnet durch ein erhebliches weltweites Wachstumspotenzial, ermöglichen ein Anknüpfen an vorhandene Kompetenzen (Forschung, Unternehmen) und haben in der Regel große Bedeutung für mindestens eine der stärksten Branchen am Standort. Neue Anwendungen und Tools, die aus den Zukunftsfelder entstehenden, können Ihre Potenziale nur entfalten, wenn sie den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Menschen gerecht werden, Neugierde und Begeisterung wecken, hinlänglich verstanden werden sowie deutliche Vorteile und ein positives Nutzererlebnis versprechen. Nicht nur deshalb steht der Faktor Mensch im Mittelpunkt.
Gesundheit und Medizin betreffen jeden einzelnen von uns unmittelbar. Die entscheidende Herausforderung ist, die Finanzierung des Gesundheitswesens langfristig im Griff zu behalten und dabei gleichzeitig die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Einen wesentlichen Beitrag können dabei neue Technologien leisten. Zentrales Ziel muss es deshalb sein, über neue technologische Lösungen die Versorgungsqualität nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen, ohne die Ausgaben zu erhöhen. Gleichzeitig muss das Gesundheitssystem im Ganzen zukunftsfest ausgestaltet werden.
Die Digitalisierung durchdringt alle Technologie-, Lebens- und Arbeitsbereiche. Sie ist die zentrale Treiberin für praktisch alle technischen Innovationen und gesellschaftlichen Veränderungen, schreitet in allen Branchen und Wirtschaftszweigen voran und stiftet Nutzen – auch für die Gesellschaft als Ganzes und jeden einzelnen Bürger. Es gilt daher, eine führende Rolle unter den Innovationsstandorten in diesem Bereich einzunehmen. Die Digitalisierung ist kein ausschließlich technisches Phänomen und sollte auch nicht auf diese Dimension reduziert werden. Genauso entscheidend sind organisatorische Innovationen und die Sicherstellung sowie Weiterentwicklung der notwendigen Kompetenzen.
Für die bayerische Industrie sind der Kraftwagen- und Maschinenbau bei Produktion sowie Forschung und Entwicklung die mit Abstand wichtigsten Einzelbranchen. Zugleich sind es die größten Exportbranchen und sie sichern Bayerns heutigen wirtschaftlichen Erfolg. In jedem Zukunftskonzept für die bayerische Wirtschaft müssen deshalb der Kraftwagenbau und seine langfristige Stärkung eine tragende Rolle spielen. Gleichzeitig gilt es, die Emissionen im Sinne des Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutzes weiter zu senken und die Infrastrukturauslastung so zu optimieren, dass den Mobilitätsbedürfnissen in Ballungsräumen wie im ländlichen Raum bestmöglich entsprochen werden kann. Erforderlich sind deshalb technologieoffene, innovationsorientierte Ansätze und eine Unterstützung insbesondere der vielen Zulieferer in den laufenden Transformationsprozessen.
Unter Big Data versteht man Datenmengen, die zu groß oder zu komplex sind oder sich zu schnell ändern, um sie mit den herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auswerten zu können. Ihre Verarbeitung dient dazu, nützliche Informationen zu gewinnen und einen Mehrwert zu schaffen, selbst wenn die Datenmengen zunächst unstrukturiert, fehlerhaft oder unvollständig sind. Der Einsatz von Big-Data-Methoden eröffnet so neue technologische und ökonomische Potenziale, die für nahezu alle Branchen Relevanz besitzen. Der Nutzen reicht von einer Optimierung unternehmensinterner Prozesse bis hin zu gänzlich neuen Geschäftsmodellen.
Die wirtschaftlichen Perspektiven Bayerns und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen auf den internationalen Märkten hängen in einem immer stärkeren Maße von der Forschung und Entwicklung in zentralen Technologiefeldern sowie der Umsetzung in wertschöpfende Produkte und Prozesse ab. Um unsere solide industrielle Basis für die Zukunft zu rüsten, müssen wir die Stärken durch Vernetzung stärken und gleichzeitig das Klumpenrisiko durch Diversifikation auflösen. Neue Technologien und daraus entstehende Innovationen sind der Schlüssel dazu. Vor diesem Hintergrund werden die technologischen Entwicklungen und Trends der kommenden Jahre sowie die Potenziale und Herausforderungen in Bayern und Deutschland analysiert